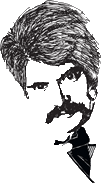CREAM
Erste Sahne oder Coverband ihrer selbst?
Eric Clapton – ja, den Namen hat er schon mal irgendwo gehört. Jack Bruce, Ginger Baker? Nein, die wohl eher nicht. Ist aber auch kein Verbrechen – besonders wenn man gerade 18 geworden ist und erst ernsthaft damit beginnt, seinen Musikempfang – auch gegen den Mainstreamdruck des kürzlich verlassenen Schulhofs und der gängigen Radiostationen – zu filtern.
Was er da hört, der 18jährige, zufällig und quasi im Vorbeigehen, ist das, was ich gerade höre:
Cream, die sich – nach fast 40 tonlosen Jahren – Anfang Mai 2005 ein par Tage lang wieder auf just die Bühnen gestellt haben, von der sie sich weiland von ihrer musikalischen Kooperation und ihren Fans verabschiedeten.
Cream, die zwischen 1966 und 1968 rockbereite Ohren füllten, wie keine andere Band.
Cream, eine der ersten „Supergroups“, Meilenstein in der Geschichte jener Musik, die man gänzlich realitätsuntauglich als U-Musik klassifizierte.
U, wie „Unterhaltung“ … aber das ist ein anderes Thema.
Cream, das ist auch noch nach so vielen Jahren: „Fresh Cream“ (1966), „Disraeli Gears“ (1967) oder „Wheels of Fire“ (1968).
Für mich, der ich „White Room“, „Sleepy time time“, „N.S.U.“ und (selbstverständlichst!) „Sunshine of your love“ nicht nur relativ zeitnah an ihrem Ursprung gehört, sondern im Übungsraum mit den ebenfalls langbehaarten Kumpels stundenlang ausprobiert, gejammt, zelebriert habe, tönt hier magisches Material aus den Boxen. Progressiv, so nannte man das Zeug damals, english spoken (obwohl natürlich auch wir wussten, dass es der altehrwürdige Blues war, der dem Ganzen die Nervenbahnen lieh).
So geht Rock. So lebt Rock, denke ich, während das starke Riff von „Politician“ die mich umgebende Zeit bricht. Es ist nicht wie bei vielen der Supergroups heute, in denen den Instrumentalisten eingeschärft wird, nur ja nicht zu improvisieren, nur ja nichts dem musikalischen Zufall zu überlassen. Bei Cream steht die Interaktion im Vordergrund – auch wenn sie natürlich nach 40 Jahren persönlicher Entwicklung der Protagonisten ein wenig anders abläuft, als 1967.
Musik, die ihre Stärken nicht einbüßen wird, das ist es für mich, was ich da höre. Ich … und der 18jährige Tastenschüler, für den es „Öhümmm, na ja, Retrokram“ ist.
Silvester 06, lief die Reunion im einstündigen Fernsehformat auf 3SAT. Pop around the clock. War ein guter Grund, mal früh aufzustehen, besonders, wenn man sich die Doppel-DVD noch nicht geleistet hat. 7 Uhr – ein Wort, aber es lohnte sich.
Royal Albert Hall, London.
Keine tonnenschwere Showausstattung auf der Bühne.
Nur die drei Musiker mit dem, was sie so unmittelbar brauchen.
Gut, in einer Hintergrundprojektion gibt’s wabernde hippieeske Farbkompositionen. Zitate des Innenlebens so manches Fans aus den Sechzigern, dem das heute hier vielleicht ein wenig peinlich sein mag. Oder als kleiner technischer Ersatz für die diesmal absolut clean wirkenden Akteure.
Keine Eric is god-Spruchbänder zu sehen, die über die Köpfe ragen.
Dafür Digitalfotoapparate.
Jäger und Sammler. Denn so etwas, wie da gerade passiert, wird nicht wiederholt werden. Und wer weiß, ob man die drei da überhaupt noch einmal sehen wird.
Jack Bruce steht da mit frisch transplantierter Leber, Ginger Baker ist arthritisgeplagt. Menschen leben mit Hypotheken auf der Zukunft – das gilt vielleicht besonders für Rock’n Roller. Gut: Clapton wirkt noch recht gesund; aber Clapton war ja – wenn man wollte – die ganze Zeit präsent, während Baker und Bruce richtig gesucht werden mussten, in Jazzclubs, kleineren Festivals, in Spartenprojekten.
Und dann: rechne mal die Lebensjahre des Trios zusammen … an die 200, summa summarum.
Warum die nun da stehen, wo sie stehen, ist absolut zweitrangig.
Ob nun, weil ein bankrotter Baker Geld für einen eigenen Polo-Platz brauchte, oder, weil die drei einfach mal wieder miteinander jammen wollten, fernab der Superstar-Querelen und damit verbundenen Egotrips und persönlichen Kleinkriegen back in the days when.
Was zählt ist, was hinten rauskommt. Oder in diesem Fall: vorne, aus der PA.
Gut, die Baker-Fills versteht man immer noch nicht alle zu 100%. Und einen Humanizer, der so mancher computergenerierten Tonproduktion noch einen Hauch menschliches Feeling einrechnen will,
ist hier beileibe nicht nötig – Metronomfixierte kaufen keine Cream-T-Shirts.
Aber die Energieerzeugung stimmt. Hier klingt weit mehr als nur ein Echo aus längt vergangenen Zeiten. Das hier sind Lehrbücher aus der echten school of rock.Die Soloausflüge – insbesonders die an der Gitarre – sind im historischen Vergleich gestraffter, kondensierter. Sie verlieren dadurch nicht, vielleicht eher im Gegenteil. Immerhin waren die Schauplätze damaliger Improvisationen bei Cream Rockneuland – und dass man da zu Expeditionen aufbrach, verstand sich von selbst.
Erfinder gefallen sich selten in Selbstbeschränkung und die Riffs von „Sunshine“, „Politician“ usw. trugen locker über eine halbe Stunde Impro; und warum soll man nicht auch als Rockschlagzeuger – wie die Kollegen im Jazz – mal die Felle ohne Saitenbegleitung befeuern.
Heute ist das Terrain abgesteckter. Sich heute zu beschränken heißt auch, zu wissen.
Außerdem gibt es Scott Henderson, Victor Wooten und Dave Weckl – alles ist im Fluss.
Wer hat gesagt, das Ganze wäre nichts als irgend eine Cream-Cover – Band?
Bullshit!
Besser hat Cream auch in den 60ern nicht geklungen. Anders, ja. Aber nicht besser.
Und was heißt hier covern? Coverd sich etwa Deep Purple, nur weil sie wieder einmal Rauch über’s Wasser ziehen lassen und ihre Fans diese Hymne zelebrieren lassen, oder Jethro Tull, wenn Ian den Flamingo spielt, oder Status Quo oder Tower Of Power, die Spencer Davis Group? Wie sieht es aus mit Peter Frampton – auch der hat vor ein paar Jahren ein über lange Zeit nicht gehörtes Programm großartig wieder auf die Bühne gebracht (live in Detroit, mit seinem alten Sideman Bob Mayo – ein echter DVD-Tip für Rockinteressierte, übrigens!).
Nein. Das hier ist authentisch.
Authentischer allemal als all die verproduzierten, verbohlenten, gesichtslosen und rasch austauschbaren Hallenfüller, wie immer die gerade auch heißen und an welchen Tanzschrittchen die auch immer gerade arbeiten mögen. Authentisch, auch wenn die Gitarre jetzt bei Clapton immer eine Strat ist – klar klingt die anders als die Modelle aus dem Hause Gibson, macht aber nicht minder Spaß und dreht nicht geringer den Krafthahn auf. Authentisch, auch – nein, gerade: weil die eine oder andere Harmonie in dem einen oder anderen Song sich heute anders anfühlt, als vor 40 Jahren.
Baker ist nicht Weckl und Clapton ist nicht Henderson. Auch das: klar.
Aber der Vergleich gibt sowieso keinen Sinn, denn Cream ist nicht Tribal Tech, Cream ist Cream.
Und das weiß keiner besser, als Cream selbst – so scheint es zumindest, denn die Aufnahmen klingen, als hätten die Herren richtig Spaß an dem gehabt, was sie da trieben.
Und dieser Spaß lässt sich auf die Hörenden übertragen.
Wenn man Musik mag und für einen Moment aufhört, in Schubladen zu hausen.
Oder immer nur Neues, Ungehörtes, Frisches hören zu wollen – was sowieso nur denjenigen gelingt, die niemals richtig dem zugehört haben, was es bereits gab.
Musik ist immer Interaktion, oder sie ist nicht.
Cream ist.