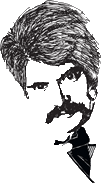Onkel des Krieges
Die Sache mit den Glitzeraugen
Vor einiger Zeit, es ist über 10 Jahre her, verschlug es mich in einen Drogeriemarkt. Toilettenpapier, Taschentücher, Zahnpasta. Der Einkaufswagen der Frau vor mir an der Kasse, war bunter. Und gefüllter. Mit beiden Händen schaufelte sie die Päckchen aus dem Einkaufswagen. Auf dem Band vor der Kasse häuften sich Tiegelchen, Fläschchen, Döschen.
„Placento-SoapOpera“, das sanfte Bügeleisen für die ersten Falten.
„Dermato-Letal“, der individuelle Sonnenbrand aus der Tube.
„Environment Cream“, wahrscheinlich für das Einfetten der unmittelbaren Umgebung. Ich kenne mich nicht aus.
„Haaiiiyh“, säuselte es aus der vom Eingang heran eilenden sonnenverbankten Männlichkeit, „langenichgesehenundgutsiehsteaus!“
Die Hoffnung der Kosmetikindustrie säuselte ihrerseits zurück, wie sehr das auch auf den Ankömmling zuträfe und dass man ja offensichtlich körperrelevant beiderseits nichts dem Zufall überlasse. Um dann noch verschwörerisch hinzuzufügen, man sei ja schließlich bereits jenseits der Vierzig. Aber doch: stolz sei man auf die eigene Erscheinung, sehr stolz, und das – bitteschön – nicht zu unrecht.
Und darauf … drehte sie sich zu mir um.
War das Eintreffen des Männchens mit der typischen Knitterpapierröte des Turbo-Sonnenbank-Abos im Gesicht schon erst einmal vom ganz persönlichen, individual- ästhetischen Standpunkt aus für mich hart zu verarbeiten gewesen, so war das Gemälde, was sich hier zwischen Stirnende und Kinnspitze präsentierte, schlichtweg asthmatisierend, heimlichgriffheischend, atemberaubend. Palimpsest, schoß es mir durch den Kopf. Nein, nicht der schwarze Tod. Du weißt, so eine bedeutungsvolle
Handschrift, die – um die eigentliche Information Unbefugten zu verbergen – über eine andere aufgetragen wurde. Aber, die Frage, ob sich eine andere Information unter dem Schlaglicht des Offensichtlichen verbergen wollte, stellte sich mir nicht. Vor dem Glitzern des Selbstgefallens in den Augen der Frau kapitulierte ich gedanklich. Und auch sonst.
Ich wandte den Kopf. Schnell. Der Medusa-Reflex, vielleicht.
Bald darauf entfernten sich die Stimmen. Untergehakt catwalkte die Grilltomate mitsamt der Leinwand gockelstolz von hinnen.
Stolz ist der Onkel des Krieges, hallte es in meinem Kopf mit jedem Schritt.
Am Abend jenes Tages besuchte uns einer meiner ältesten Freunde. Er lebt in Prag und ist so nett, uns über einen Teil des – damals noch – tschechoslowakischen Weinbaus auf dem Laufenden zu halten.
Auch dieses Mal packte er Flaschen aus. Er sei sehr froh über die qualitativen Fortschritte auf der Angebotspalette der Rebkultur seiner Heimat, gab er zu verstehen. Und – doch, ich hatte richtig gesehen – da war es wieder: dieses Augenglitzern aus dem Drogeriemarkt.
Ich stellte Gläser auf den Tisch. Ein „Frankovka“, meines Erachtens ein Blaufränkisch, füllte diese sogleich mit einem recht transparenten Rubin samt Blautönen zum Rand hin. 2000er Jahrgang. 10,5 Volumen Alkohol. „Mutenicka Vinarska“.
So das Etikett. Ein Wein aus Mähren, sagte mein Freund.
Und was soll ich sagen? Wein war es schon.
Roter. Irgendwie.
Mühsam wie die stumpfe Klinge bei einer Naßrasur führte ich den Stift, um doch etwas zu notieren. Etwas in Richtung „schlankes Mittelgewicht, trocken, ordentliches Tannin, nach hinten recht dünn werdend, dezentes Bitter, kurz“.
Der folgende „Rulandske Modre“ von 99 mit „Minimum 10% Alkohol“ von „Arcibiskupske Vinne sklepy“ machte es mir nicht leichter. Purpur-Rubin. Rotwein wieder. Und ich habe fertig.
Du willst es trotzdem genauer? Na dann vielleicht: verhaltene Nase, schlankes Mittelgewicht, ein – wenn man so will – Allrounder. Weil er alles sein könnte. Und nichts. Ein Wein, den ich deshalb nicht wieder erkennen würde, da er kaum etwas bot, an das man sich halten konnte. Nicht einmal eine genaue Herkunftsbezeichnung. Denn das Rückenetikett wies darauf hin, daß die Reben vielleicht aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen könnten. Ganz eindeutig verhielt es sich da aber wohl nicht – so meinte mein Freund, denn meine eigenen Tschechischkenntnisse kommen über ein fröhliches „Ahoi“ nicht hinaus.
Und damit ist eigentlich auch schon einiges über den dritten im Bunde, einen Cabernet Sauvignon von 99 und vom gleichen Erzbischofsgut gesagt. Wobei hier eine frappierende Distanz zu dem erstaunte, was ich bislang als sortentypisch erfahren hatte.
Wein schmeckt halt da und dort anders als anderswo, murmelte ich vor mich hin.
Denn da war diese Sache mit dem Stolz und dem Onkel des Kriegs. Und wer will schon Krieg mit einem Freund?
Ich verfiel auf Plan B. Der geht von einem anderen Spruch aus, dem nämlich, daß Stolz der schlechte Witz ist, über den der
Fremde in dir eines Tages befreit lachen würde. Also: anderer Wein auf den Tisch. Das Alternativprogramm.
Holte Weine, von denen ich meinte, sie könnten ihm gefallen, von der Loire, der Rhone. Und als diese ihre Wege in die Gläser gefunden hatten, sprang ich auf, meinte, ich hätte Weiteres aus meinem Keller vorbereitet.
Und da muß dann sich wohl so ein Glitzern in meine Augen geschlichen haben. Denn die Antwort war ein freundliches Lächeln mit der höflichen Bemerkung: Wein schmecke halt da und dort anders als anderswo. Und: nein, er halte sich lieber an die landsmännischen Tropfen.
C’est la vie – so ist der Wein.
Und klar: wer will schon eine Glitzeraugenaffäre?