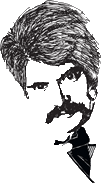Facebook
Ohne Netz und doppelten Boden
Ruhig ist es hier. Etwas zu weiß vielleicht, aber ruhig. Die Leute sind nett, höflich.
Gelegentlich höre ich Schreie vom Flur.
Geht mich nichts an, draußen ist draußen. Hier drin, zwischen den weißen Wänden, zwischen der weißen Bettwäsche, vor der meist verschlossenen weißen Tür herrscht Ruhe. Endlich Ruhe.
Ich habe hier alles, was ich brauche. Bekomme zu essen, zu trinken. Manches schmeckt sogar. Irgendwie. Die Medikamente beeinflussen den Geschmackssinn, daher weiß ich die meiste Zeit eh nicht, was da auf dem Teller sein soll.
Keine Dusche für mich alleine. Kein Fernsehen, kein Computer.
Kein Facebook.
Vor allen Dingen kein Facebook!
Es war vor etwas mehr als einem Jahr. Eine Freundin kam von einem ausgedehnten Trip durch Bolivien zurück.
Sie hatte Fotos gemacht und auf Facebook geparkt. Nur anmelden müsste ich mich da, kostenlos, problemlos, dann könnte ich in ihren Aufnahmen stöbern. Sogar meinen Senf zu dem der anderen dazu geben. Wenn ich wollte.
Wollte ich nicht. Was geht mich der Senf der anderen an, was die anderen der meinige. Aber rasch mal über die Bilder schauen.
Es waren Schnappschüsse, mehr nicht.
Einmal bei Facebook, wollte ich dann aber auch irgendetwas im Profil hinterlegen. Einen Spruch, ein Foto. Sah sonst so kahl, unverputzt aus. Und so kamen die Freunde.
Erst spärlich, dann immer mehr. 376 waren es nach gut einem Jahr geworden, als mir eines Morgens auffiel, dass einer fehlte.
Na und, was soll sein – da hat halt jemand keine Lust mehr am Spiel. So ist’s im Leben, einer geht, ein anderer kommt.
Nur dass kein anderer kam.
Im Gegenteil, ein paar Tage später waren es sogar nur noch 373.
Ich verstand. Meine Beiträge ließen es wohl an Originalität missen. Danke für den Hinweis, Leute.
Ich biss in mein Brötchen, dachte nach, kritzelte etwas auf einen Zettel, strich aus, kritzelte erneut und tippte nach dem Frühstück ein: „Der Teufel steckt im Detail, nur die Götter gibt es en gros.“
Abends dann, nach dem Nachhausekommen, fuhr ich den Rechner hoch, klickte mich in Facebook ein und blickte auf den Weltkugelbutton für die Benachrichtigungen.
Nichts.
Dafür ein weiterer Freund weniger.
„Pfffft“ teilte ich dem Bildschirm mit, der sich ungerührt gab. Das mit dem Teufel und den Göttern war offenbar zu quer gegen den christlich-abendländischen Mainstream, analysierte ich rasch. Also populärere Kulturkritik. Irgendwas gegen das unterirdisch schlechte Fernsehprogramm auf allen Sendern – das geht immer. „Nicht mehr auf BILD-TV warten, die anderen Sender bemühen sich doch so sehr!“ Jawoll uuuuuund … gepostet.
„Schauspieler, die einen Musiker am Instrument mimen – da guck ich doch lieber Berlusconi, wie er die Cäsaren gibt.“ Herrlich. Gepostet. Noch einen hinterher: „Sicheres Wahlversprechen bei Klimawandel und Polkappenschmelze: ‚Deutschland kann Meer‘.“ Und Enter.
„Früher haben wir unsere Kinder erzogen! Kuck links, kuck rechts. Heute ist Erziehung nicht mehr möglich; heute gibt es Ampeln.“ Status-Update und fertig. Wenn das kein Homerun ist.
Dachte ich. Quasi siegessicher.
Und wartete. Eine kleine Weile.
Nichts rührte sich auf dem Schirm. Kein Kommentar. Nicht mal ein läppisches „Like“. Ich wollte die Kiste schon frustriert runterfahren, da … wer sagt’s denn: ein Daumen unter der Sache mit den Polkappen.
Von meinem Onkel. Was so was von überhaupt nicht zählt.
Eher im Gegenteil. Beileid von den Verwandten auf Facebook. Geht gar nicht.Also noch mal mit Anlauf, aber diesmal mit echter Systematik. Feldforschung, das ist der Schlüssel. Drei Tage lang beobachtete ich minutiös das Geschehen auf der Seite, wann immer ich Zeit hatte. Nahm einen Laptop mit zum Job, um möglichst nichts zu verpassen. Dann stand mein Ergebnis fest: am beliebtesten waren Statusmeldungen über das Wetter, gefolgt von Einträgen, die kundtaten, wo man sich gerade befand.
Umgehend legte ich mir ein iPhone voller Pakete mit Social-Network-Apps zu. Fotos vom Morgenhimmel, dem Horizont am Mittag und der einbrechenden Dämmerung wurden instant hochgeladen, reich garniert mit Anmerkungen wie: „Auch der Early Bird ist letztlich nur ein komischer Vogel“ oder You-Tube-Songs wie „Good day sunshine“, „Morning has broken“ oder „When the night comes“.
Ich suchte Discotheken, Bars und Restaurants auf, nur um Facebook zu zeigen, wo ich mich gerade befand und wie ich drauf war; und um ganz sicher zu gehen, nahm ich gleich noch ein paar Fußballplätze, Stadtfeste und Schlagerabende mit.
Meine Freundeszahl sank unaufhaltsam weiter.
Stundenlang studierte ich meine Freundesliste, führte darüber Buch, wer mich wann und aus welchem vermuteten Grund verlassen hatte.
Es muss zu der Zeit gewesen sein, als es unter meinem linken Auge gelegentlich zu zucken begann. Die ganzen Discos waren einfach nicht gut für mich. Ich musste einfach meinen Schreibstil optimieren. Heiter-besinnlich, aber mit Tiefgang.
Tiefgang ist immer gut, dachte ich und plötzlich hatte ich das Bild der Titanic vor mir. Ich schob es beiseite und tippte im Stakkato auf der Tastatur herum: „Lese gerade: ‚Abnehmen beginnt im Kopf‘. Als Zeuge aktueller politischer Debatten muss ich traurig zustimmen.“ Hah, spitz aber nicht persönlich. So wird das was. Enter.
„Meinte immer, die Nordic-Walker gabeln mit ihren Pieksern Verlorenes auf; dabei wollen sie Aufgegabeltes verlieren.“ Na, ist das ein Augenzwinkern, hah! Enter.
„In letzter Zeit finde ich einfach kein gutes Haar in der Suppe.“ Ja, ruhig einen kleinen Stich ins Absurde. Enter.
„Nicht Fotografien stehlen die Seele, es sind die Plakate.“ Enter.
Ich war mittlerweile bei 212 Freunden angekommen. Ein Tiefpunkt. Nicht hinnehmbar.
Was mich nur noch mehr anspornte. Ich m-u-s-s-t-e einfach besser werden.
Das Radio lief ohne Pause im Hintergrund, der Fernseher blieb einfach an, ich abonnierte drei Tageszeitungen und vier Wochenmagazine, ständig auf der Suche nach Meldungen für FB. Ich grübelte die meiste Zeit des Tages darüber, was sich verwerten, aufpeppen, malträtieren, mit lapidaren, sarkastischen, ironischen, brüllend witzigen Kommentaren versehen lassen könnte.
Bei meinem Job war ich da schon einige Zeit nicht mehr aufgetaucht. Das Augenzucken war Dauergast in meinem Gesicht, seit sich die Freundeszahlen bedrohlich der 100er-Marke näherten, ich nahm es kaum noch wahr.
Telefonate überließ ich komplett dem Anrufbeantworter. Auf die Türklingel reagierte ich nur noch, wenn ich den Pizzaservice oder den Boten vom Getränkemarkt erwartete. Ich ging nicht mehr auf die Straße, es sei denn, ich erhoffte mir etwas Schreibbares davon.
Als die Leute plötzlich bei mir in der Wohnung standen, nahm ich sie zuerst gar nicht wahr.
Irgendwie merkte ich wohl, dass Vorhänge zur Seite geschoben, Fenster geöffnet wurden.
Sie bahnten sich einen Weg durch die auf dem Boden liegenden Flaschen, Kekstüten, Pizzakartons.
Eine ernst wirkende Frau mittleren Alters legte mir die Hand auf die Schulter, was in Ordnung war, da ich
gerade nicht tippte.
Ohne mich umzudrehen fragte ich sie, was sie von dem Statement: „Politiker – für uns in Berlin. Und Florian Silbereisen singt ganz ehrlich nur für dich“, hielte, oder ob vielleicht: „Stimmrecht: das Recht, dass das, was einem als Wahlbürger erzählt wird, auch stimmt“ den Nagel eher auf den Kopf treffen, das Ganze pointierter zum Ausdruck, die Angelegenheit noch schärfer fokussieren, den Punkt direkter angehen …
Jemand brachte mir eine Hose, ein T-Shirt. Was sollte ich damit, der Bademantel genügte mir. Schon seit Wochen. Bequem.
Ob ich mich noch etwas waschen wollte, fragte jemand. Ich blendete das aus, denn mir kam gerade wieder eine Idee. „Hört mal“, rief ich, „wie ist der: ‚Und wenn der ganze Ort neu gepflastert wird, es sind doch immer noch dieselben Hacken, die da auftreten.'“
„Immer dieselben Hacken, ja klar, natürlich, sehr schön, sehr schön, uuuunbedingt“, sagte einer. Vielleicht eine Spur zu freundlich.
„Unbedingt“, echote ein anderer, „ist das von Grass?“, und erhielt postwendend von seinem Nebenmann einen knappen Boxhieb an den Arm.
Den Einstich merkte ich kaum und bevor ich wegdämmerte, meinte ich zu hören, wie einer sagte: „Schon der vierte diese Woche, traurig das.
Ruhig ist es hier.
Weiß, aber ruhig.
Nächste Woche darf ich das erste Mal in den Gemeinschaftsraum.
Nach nur drei Jahren hier auf Station.
Und die neuen Medikamente lassen zwar alles gleich schmecken, aber ich merke wieder, wenn jemand mit mir spricht.
Und hin und wieder habe ich auch wieder eine Idee.
Gerade jetzt zieht mir doch etwas vor das innere Auge; ich kann es sehen, beinahe klar: „Uns allen wurde der Lebensweg vorgezeichnet. Ich musste natürlich einen verdammten Kubisten erwischen.“
Was für ein Status-Update! Vielleicht die Wende, klingt vielleicht nach einem Comeback.
Pah, was heißt hier „vielleicht“ – das ist der Knaller, ein Dutzend würde ich sagen, was sage ich, zwei Dutzend, drei Dutzend „Likes“ auf einen Schlag. Minimum. Und Freunde. Freunde!
Ich muss hier raus – und zwar schnell!