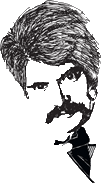Who the fuck is Proust?
The Black Keys und die Vergangenheitsbewältigung.
Einfach entwertet. Nichts klappt mehr, alles billig geworden, austauschbar. Futsch und weg die Solidität des Made in Germany. So erzählen es dir alle.
Das bessere Früher, das Eswareinmal der guten aber leider in der Zeit verwehten Welt hat Hochkonjunktur. Irgendwie war es bei irgendwem zwar immer angesagt, Vergangenes posthum mit Lorbeeren zu verblättern. Aber „irgendwie“ und „irgendwer“, die unbestimmt Vereinzelten, haben mittlerweile einer weit sichtbaren Front an hochmotivierten Retrohuldigern platz gemacht.
Man frönt dem kalendarischen Plusquamperfekt.
Denn früher kamen die Bahnen pünktlich, im Rollmops war kein Dioxin, sondern eine Gurke und die Seeleute konnten sich noch in ihrem Takelagezeug festhalten.
Zum Glück hat jeder noch eine, seine Vergangenheit. 1A Stoff gegen die Impertinenz der Gegenwart. Doch die ist nicht immer gleich wiederzufinden, die muss entfirnt, freigelegt werden. Und da hat jeder seine eigenen Methoden. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit siehst du so manchen Proust-Verehrer den Einkaufswagen im Supermarkt mit kiloweise Butterkeksen, Nappos, Prinzenrollen und Werweißwasfüreinzeug zuschaufeln, an dem es dann zu schnüffeln gilt, als ginge es darum, Vorwerk Konkurrenz zu machen. Die nasenmäßig angeschobene Rolle rückwärts in vergangene Zeiten, Erinnerungen per Geruch, die Methode „Duftnote“.
Andere bekommen das besser ohne Duft hin. Bleibt die Note.
Mit Musik geht alles besser. Auch der Zeitsprung nach hinten. Für den man seit neuerer Zeit immer weniger die alten Scheiben herauskramen muss. Eine ganze Reihe Bands spielt plötzlich wieder ganz so, wie in den verflossenen Tagen. Manche mehr – wie jetzt immer öfter Ben Harper – manche weniger.
Aber irgendwie den Vogel abgeschossen zu haben scheinen diesbezüglich die „Black Keys“.
Kaum schallen die Jungs mit ihrem Werk „Brothers“ aus der Anlage, verschwimmt der Raum, die Konturen beginnen Fahrt aufzunehmen, rasen verzerrt an deinem Auge vorbei.
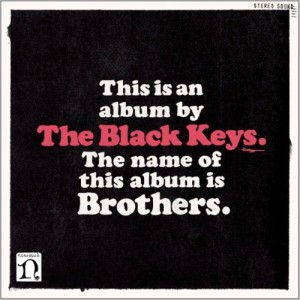

Das ist kein Zeitsprung, das ist ein Achterbahnsalto satte 40 Jahre Richtung Beginn der Zeitrechnung.
Die Band rockt sich durch die Songs, wie eine Kellerband aus der angegrauten Reihenhaussiedlung in der Vorstadt irgendwann in den frühen 70ern.
Wenn da ein Saitenkünstler von einem „cleanen“ Sound sprach, dann meinte er nicht unbedingt eine durchgestimmte Klampfe. Und das kleine Trömmelchen durfte durchaus mit leicht durchhängenden Snares völlig unfunkig bearbeitet werden.
Dass die Grooves hier Handwerk und kein Computerrechengang sind, ist selbstredend und erzeugt unmittelbar Sympathie. Und weil hier weniger gerechnet und mehr gejammt wird, sind die Beats nicht immer so verschachtelt, nicht immer so tight übereinander, kurz: nicht immer ganz so gestaltet, wie sie auf einem Notenblättchen den Eindruck hätten vermitteln müssen, wenn sie denn je aufgeschrieben worden wären.
Die Livebands auf den Schulfeten von 1974, die ihre Orange- und Marshalltürme selbst angekarrt und geschleppt hatten und deren Gitarristen allein schon deshalb Helden waren, weil sie sich Samba pa ti draufgeschafft hatten, scheinen ihren Wiedergänger auf Tour geschickt zu haben.
Auch der T-Rex Rumpelgroove fehlt nicht.
Aber irgendwie funktioniert das. Auf eine seltsame Art und Weise.
Jedenfalls weisst du, wenn die CD durchgelaufen ist, dass heute der Zug bestimmt pünktlich sein wird. Denn so ein Zeitriss kann schlicht nicht völlig ohne Wirkung bleiben. Ob allerdings die Klosterschulen auch wieder boomen, bleibt fraglich.
So viel Macht haben sie dann selbst die Black Keys nicht.
Oder?